Ergiebige Dauerregenfälle an der Ostseite eines quasistationären Höhentiefs über dem nahen Südosteuropa führten
Ende Mai und Anfang Juni 2013 zu Überschwemmungen und teilweise katastrophalem Hochwasser im nördlichen Alpenraum,
in Tschechien und im Süden und Osten Deutschlands. Regenmengen bis zu 400 mm binnen 4 Tagen am Alpennordrand verursachten
an der Donau eine Jahrhundertflut. In den neuen Bundesländern führte die Saale ein Jahrhunderthochwasser. Abschnittsweise war
die Situation an Elbe und Vereinigter Mulde kritischer als beim großen Elbehochwasser 2002.
GROSSWETTERLAGE UND EINORDNUNG
Vom 30.05. bis 03.06.2013 gingen über Südostdeutschland, Tschechien,
Nordösterreich und der Nordostschweiz ergiebige Starkregenfälle nieder und verursachten an vielen Flüssen starkes Hochwasser.
In Deutschland waren besonders die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern,
in Österreich vor allem der Vorarlberg, Nordtirol, das Salzburger Land und Oberösterreich betroffen.
In Bayern führte die Donau, in Sachsen-Anhalt die Saale ein Jahrhunderthochwasser. Verantwortlich für die heftigen Niederschläge
war ein nur zögerlich ostwärts propagierendes Cut-Off-Höhentief über dem europäischen Kontinent, das auf seiner Ostseite beständig
feuchtlabile Luft subtropischen Ursprungs in weitem Bogen über Nordosteuropa bis nach Mitteleuropa führte. Mehrere, um den
abgeschnürten Höhentrog kreisende Kurzwellentröge leiteten über dem nahen Südost- und Osteuropa wiederholt Zyklogenesen ein.
Dort etablierte sich tiefer Luftdruck, während im Verlauf des Starkregenereignisses von
Westen her mit einem heranrückenden Hoch Druckanstieg erfolgte. Damit baute sich über Mitteleuropa eine starke Nordströmung auf,
in der gebietsweise stürmische Böen oder Sturmböen auftraten. Da das Erdreich durch die Niederschläge stark aufgeweicht war,
sorgten bereits Sturmböen für etliche umgestürzte Bäume. Mit dem kräftigen Nordwind stellten sich besonders in den Luvlagen der
Mittelgebirge und der Nordalpen ergiebige Stauniederschläge ein. Dies war am Erzgebirge, am Thüringer Wald, am Fichtelgebirge,
an Fränkischer und Schwäbischer Alb, am Schwarzwald und an den Nordalpen der Fall. Zusätzlich waren die Niederschläge in der
feuchtlabilen Luftmasse konvektiv verstärkt, besonders in Ostdeutschland zeitweise auch gewittrig.
In den Alpen lag die Schneefallgrenze im Zeitraum der stärksten Niederschläge zwischen 1700 und 2200 Meter, so dass
in den hohen Lagen zumindest ein Teil der Niederschläge als Schnee gebunden wurde. In Stützengrün-Hundshübel in Sachsen
regnete es bis 03.06., 6 UTC in 96 Stunden 224 mm, in Burladingen-Hausen auf der Schwäbischen Alb waren es 159 mm.
Spitzenreiter war Aschau-Stein am Bayerischen Alpenrand mit 405 mm in nur 4 Tagen (weitere Niederschlagssummen
siehe Chronologie).
Die erste Tiefdruckentwicklung startete ab dem 29.05., als über dem nördlichen Balkan Tief "Frederik" entstand, das
unter Verstärkung zum 31.05. nach Nordtschechien geführt wurde. Vor allem von Osteuropa und Polen her
einsetzende Warmluftadvektion führte zu kräftigen Niederschlägen, die sich über Südostdeutschland ausbreiteten.
Danach verlagerte sich das Tief an den dazugehörigen Kurzwellentrog gekoppelt wieder nach Süden und dissipierte am 02.06. über dem Alpenraum.
Gleichzeitig trat das nächste Tiefdruckgebiet "Günther" in Erscheinung, das seine Existenz einem weiteren Kurzwellentrog
verdankte und am 01.06. über Polen analysiert wurde. "Günther" schlug auf der Nordseite des Höhentiefs eine westliche bis
südwestliche Zugbahn ein, führte analog zu "Frederik" die herumgeholte feuchtwarme Luft auf seiner Rückseite südwärts und
hielt damit das Herbeiführen niederschlagsträchtiger Luftmassen aufrecht. Erst als "Günther" zum 03.06.
nach Osteuropa abzog und sich abschwächte ließen die ergiebigen Regenfälle in Mitteleuropa und im Nordalpenraum nach
(detaillierterer Wetterablauf siehe Chronik).
Alternativ kann die wiederholte Entwicklung mehrerer Bodentiefdruckgebiete im Bereich des abgeschnürten Höhentroges mit Hilfe der potentiellen
Vorticity beschrieben werden. Die potentielle Vorticity (PV) ist eine meteorologische Größe, die thermodynamische Prozesse mit
dynamischen Vorgängen in der Troposphäre verknüpft. Zu Beginn des Starkregenereignisses herrschten im Zentrum des Höhentiefs
im 500-hPa-Niveau (etwa 5.5 Kilometer Höhe) Temperaturen zwischen -22 und -25 °C, ein für Ende Mai in diesen Breitenkreisen
außergewöhnlich tiefer Temperaturbereich. Die Höhenkaltluft begünstigte starke Konvektion, welche in der mittleren
Troposphäre zu verstärkter Freisetzung latenter Wärme führte. Dabei entstand in der Höhe eine positive PV-Anomalie, die am Boden die
Entwicklung von Tiefdruckgebieten begünstigte.
Bereits vor den Starkregenfällen waren die Bedingungen für Hochwasser in Mitteleuropa günstig. Im Mai
häuften sich über Europa Cut-Off-Tiefs, die lange Zeit relativ ortsfest verweilten und überdurchschnittlich viel Regen
brachten. Der Monat fiel in Deutschland im bundesweiten Flächenmittel mit 178 % der langjährigen
Niederschlagssumme deutlich zu nass aus. Insgesamt war der Mai 2013 der zweitnasseste seit 1881. Thüringen verbuchte
mit einer flächengemittelten Monatssumme von 180 mm sogar einen neuen Monatsrekord. Daher waren die Böden weitgehend
gesättigt und die Flüsse führten bereits viel Wasser. Der abgeschnürte Höhentrog am Monatsende und Anfang Juni, welcher für das starke Hochwasser
verantwortlich war, sollte das vorläufig letzte Cut-Off-Tief in der Reihe der Abtropfvorgänge sein. Somit war die
Großwetterlage als "Trog/Mitteleuropa" einzustufen und nicht als klassische Vb-Wetterlage, bei der Tiefdruckgebiete vom Ligurischen Meer
über die Ostalpen bis zum Baltikum ziehen und häufig schadenträchtige Hochwasserlagen in Mitteleuropa auslösen.
Höhen- und Bodenwetterkarten zur Großwetterlage
500-hPa-Geopotential/Bodendruck, 850-hPa-Temperatur, 850-hPa-Pseudopotentielle Temperatur, Bodendruckanalysen
Quellen: wetter3.de,
DWD / FU Berlin |
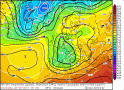 |
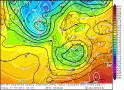 |
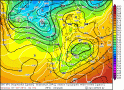 |
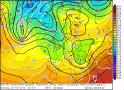 |
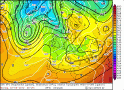 |
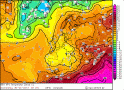 |
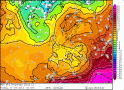 |
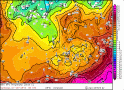 |
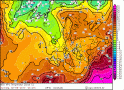 |
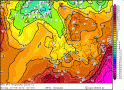 |
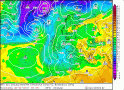 |
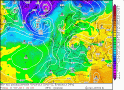 |
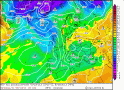 |
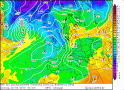 |
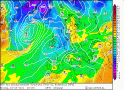 |
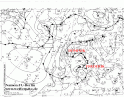 |
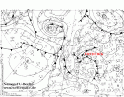 |
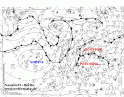 |
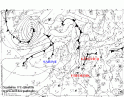 |
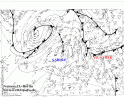 |
| 30.05.2013, 00 UTC |
31.05.2013, 00 UTC |
01.06.2013, 00 UTC |
02.06.2013, 00 UTC |
03.06.2013, 00 UTC |
Satellitenbilder
|
VIS-Satellitenbilder |
Quelle: B.J. Burton |
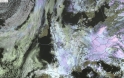 |
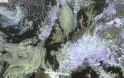 |
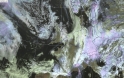 |
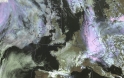 |
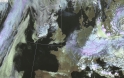 |
| 30.05.2013, 12 UTC |
31.05.2013, 12 UTC |
01.06.2013, 12 UTC |
02.06.2013, 12 UTC |
03.06.2013, 12 UTC |
Niederschlagsradarbilder
|
Niederschlagsradarbilder Deutschland und Umgebung |
Quelle: DWD |
 |
 |
 |
 |
| 30.05.2013 |
 |
 |
 |
 |
| 31.05.2013 |
 |
 |
 |
 |
| 01.06.2013 |
 |
 |
 |
 |
| 02.06.2013 |
 |
 |
 |
 |
| 03.06.2013 |
Vergleich mit früheren Hochwasserereignissen
Brennpunkt der Hochwasserlage 2013 waren Bayern sowie Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zurückliegende
markante Hochwasserereignisse in diesen Gebieten gehen in Ostdeutschland auf das Elbehochwasser 2002, in Bayern
auf das Alpenhochwasser 2005 zurück. Beide Hochwasser waren einer Vb-Wetterlage geschuldet. Beim Elbehochwasser 2002 lag
der Niederschlagsschwerpunkt mehr im zentralen und östlichen
Erzgebirge und auch in Tschechien. Damals wurden in Zinnwald-Georgenfeld binnen 24 Stunden 312 mm gemessen - bis heute
die deutschlandweit höchste gemessene Tagesniederschlagssumme. In 4 Tagen summierte sich dort der Regen sogar auf 407 mm.
2013 fiel der meiste Regen weiter westlich entlang des Thüringer Waldes und des Westerzgebirges. Spitzenreiter war der Ort Stützengrün-Hundshübel in Westsachsen
mit einer 96-stündigen Niederschlagssumme von 224 mm, verglichen mit den 407 mm weitaus weniger, allerdings verliefen
dort die Wochen vor dem Starkregenereignis überdurchschnittlich nass. Dadurch stiegen die
Pegel an einigen Flüssen in Westsachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt (z.B. an der Saale) höher als im Jahr 2002.
An der Vereinigten Mulde war die Situation abschnittsweise auch kritischer als beim großen Elbehochwasser 2002.
Dagegen konnten in Sachsen entlang der Elbe die Pegelstände von 2002 nicht erreicht werden, da der Wassereintrag
aus Tschechien und aus dem östlichen Erzgebirge geringer ausfiel. Verglichen mit 2002 registrierte Zinnwald-Georgenfeld
nur eine verhaltene 4-tägige Niederschlagssumme von 154 mm.
In Bayern ereignete sich das letzte große Hochwasser im August 2005. Verglichen mit 2013 lag damals der Schwerpunkt weiter westlich
von der Ostschweiz bis zum Inntal und nicht vom Karwendel bis ins Salzburger Land. Daher fiel 2005 der 96-h-Niederschlag in
Balderschwang mit 260 mm höher, an den weiter östlich gelegenen Stationen Kreuth-Glashütte und Aschau-Stein dagegen
deutlich niedriger aus. Vor allem Iller und Lech und auch der Oberlauf des Inn führten damals mehr Wasser.
Im Juli 1954 führte ein noch markanteres Niederschlagsereignis zu einem weiteren starken Hochwasser, vor allem an der Donau. Damals regnete
es in Aschau-Stein binnen 4 Tage 487 mm, mehr als 2013 mit 407 mm. Dieses Starkregenereignis hat maßgeblich
zur deutschlandweit höchsten monatlichen Niederschlagssumme von 777 mm beigetragen, die einmal im Juli 1954 in Aschau-Stein
und ein zweites Mal in Oberreute (BY) im Mai 1933 beobachtet wurde.
Vergleich der 96-h-Niederschlagssummen vom Hochwasser 2013 mit früheren markanten Hochwasser
im Jahr 2002 (Elbe) sowie im Jahr 2005 und 1954 (Alpen/Donau) an ausgewählten Stationen
Datenquelle: DWD |
| Ort |
Jahr/Zeitraum |
RR |
Vergleich |
RR |
Vergleich |
RR |
Donaueinzugsgebiet:
Aschau-Stein (BY)
Kreuth-Glashütte (BY)
Balderschwang (BY)
Elbeeinzugsgebiet:
Zinnwald-Georgenfeld (SN)
Dippoldiswalde-Reinberg (SN)
Stützengrün-Hundshübel (SN) |
2013
30.05.-03.06., 6 UTC
30.05.-03.06., 6 UTC
30.05.-03.06., 6 UTC
2013
30.05.-03.06., 6 UTC
30.05.-03.06., 6 UTC
30.05.-03.06., 6 UTC |
405 mm
373 mm
203 mm
154 mm
145 mm
224 mm |
2005
20.08.-24.08., 6 UTC
20.08.-24.08., 6 UTC
20.08.-24.08., 6 UTC
2002
11.08.-15.08., 6 UTC
11.08.-15.08., 6 UTC
10.08.-14.08., 6 UTC |
120 mm
221 mm
260 mm
407 mm
240 mm
175 mm |
1954
07.07.-11.07., 6 UTC
07.07.-11.07., 6 UTC
07.07.-11.07., 6 UTC
|
487 mm
258 mm
136 mm
|
|
|
500-hPa-Geopotential/Bodendruck |
Quelle: wetter3.de |
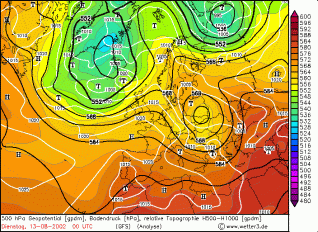 |
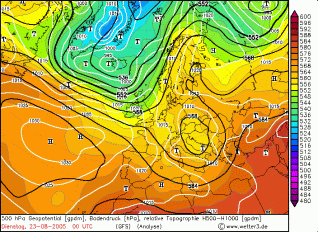 |
| Situation am 13.08.2002 |
Situation am 23.08.2005 |
CHRONOLOGIE DES EREIGNISSES (zum Ereignis begleitend täglich erstellte Texte)
Freitag, 31. Mai 2013, 18:00 MESZ
Ende Mai 2013 ist die synoptische Situation über Europa geprägt von einem quasistationären und kräftigen
Höhentief über dem Ostalpenraum und dem nahen Südosteuropa. In dessen Zentrum werden im 500-hPa-Niveau
(etwa 5,5 Kilometer Höhe) zwischen -22 und -25 °C erreicht, ein für Ende Mai in diesen Breitenkreisen
außergewöhnlich tiefer Temperaturbereich. Ein korrespondierendes Bodentief konnte zum Nachmittag des 31.05.
mit recht kräftigem Kern unter 1000 hPa über Tschechien ausgemacht werden. Entgegen dem Uhrzeigersinn (auf der Nordhalbkugel zyklonal)
wird um das Höhen- und Bodentief beständig feuchte Warmluft subtropischen Ursprungs von Südosteuropa in weitem Bogen über Nordosteuropa bis
nach Mitteleuropa geführt. Mitteleuropa und der Alpenraum liegt rückseitig der Drucksysteme in einer kräftigen Nord- bis Nordostströmung.
Vorderseitig eingelagerter Kurzwellentröge entstehen unter Hebungsprozessen wiederholt Tiefdruckgebiete und dazugehörige Frontensysteme
mit ausgedehnten und ergiebigen Niederschlagsgebieten, die besonders die Südosthälfte Deutschlands und die angrenzenden Nachbarländer erfassen.
Nach Osten hin fallen diese in der eingebundenen Warmluft häufig gewittrig aus, Richtung
Westen und Süden überwiegen stratiforme, aber nicht selten konvektiv verstärkte Regenfälle. Mit der
nördlichen Anströmung treten vor allem an den quer zur Strömung ausgerichteten Mittel- und Hochgebirgen orographische Staueffekte
auf, die zur Verstärkung der Niederschlagsintensität führen. Dies ist besonders am Erzgebirge, am Thüringer Wald, am Fichtelgebirge, an Fränkischer und
Schwäbischer Alb, am Schwarzwald und an den Nordalpen der Fall.
| Top-10 der 24-h-Regenmengen Deutschland, 30.05.-31.05.2013, 06 UTC |
| Aschau-Stein (BY) | 70,8 mm |
| Obere Firstalm/Schlierseer Berge (BY) | 57,4 mm |
| Bobeck (TH) | 57,2 mm |
| Stuetzengruen-Hundshuebel (SN) | 56,2 mm |
| Neuhaus am Rennweg (TH) | 49,3 mm |
| Carlsfeld (SN) | 47,9 mm |
| Marktschellenberg (BY) | 47,1 mm |
| Frankenberg-Altenhain (SN) | 47,1 mm |
| Reit im Winkl (BY) | 45,1 mm |
| Langenwetzendorf-Goettendorf (TH) | 45,1 mm |
|
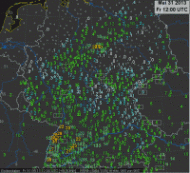 |
6-h-RR [mm] bis 31.05., 12 UTC
Quelle: DWD Ninjo |
|
Bis zum Nachmittag des 31.05. kamen über Südostdeutschland bereits beträchtliche Regenmengen zusammen. In Sachsen, Thüringen,
Bayern und Baden-Württemberg fielen verbreitet über 40 mm, in der Spitze auch über 70 mm (Aschau-Stein/BY).
Vielerorts ist das Erdreich mit Wasser vollständig gesättigt und kann weitere Regenfälle nur noch sehr schlecht oder
garnicht mehr aufnehmen. Die Folge sind hohe oberflächige Abflüsse und massive Wassereinträge in die Bäche, Flüsse und
später auch in die großen Ströme wie Elbe, Rhein oder Donau. Zur Stunde führen in Baden-Württemberg vor allem die
Neckarzuflüsse und die Tauber 2-jähriges, örtlich auch 10-jähriges Hochwasser (z.B. die Lauter bei Wendlingen). Auch
an einigen Schwarzwaldflüssen melden die Pegel 2-jähriges Hochwasser. In Bayern ist der Norden betroffen an den Oberläufen
des Mains und an den Zuflüssen der Regnitz und Pegnitz. Sachsen meldet an Mulde und Elster hohe Pegelstände, in Thüringen
führen Saale, Werra, Unstrut und Ilm Hochwasser. Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick zur aktuellen Lage.
Niederschlagssummen Deutschland, Bundesländer und ausgewählte Stationen
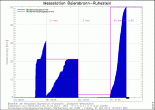
|
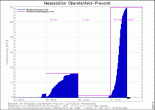
|
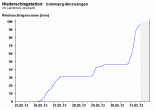
|

|
Baiersbronn-Ruhestein (BW)
Quelle: HVZ
|
Oberstenfeld-Prevorst (BW)
Quelle: HVZ
|
Colmberg-Binzwangen (BY)
Quelle: HND
|
Aschau-Stein (BY)
Quelle: HND
|
Kritische Flusspegel (Auswahl) in Südostdeutschland
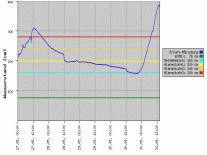
|
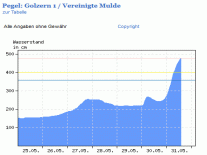
|
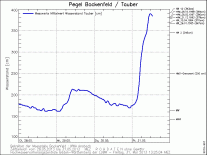
|
Erfurt-Möbisburg (TH), Gera
Quelle: TLUG
|
Golzern (SN), Vereinigte Mulde
Quelle: Sachsen Wasserwirtschaft
|
Bockenfeld (BW), Tauber
Quelle: HVZ
|
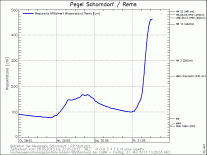
|
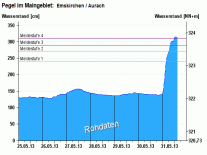
|
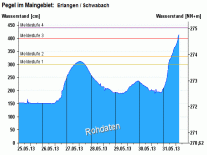
|
Schorndorf (BW), Rems
Quelle: HVZ
|
Emskirchen (BY), Aurach
Quelle: HND
|
Erlangen (BY), Schwabach
Quelle: HND
|
Prognosen für die Folgetage
Aktuell (18:00 MESZ) liegt ein weiteres Starkregenband von Brandenburg über Sachsen-Anhalt und Thüringen bis
zum Alpenrand quer über Deutschland. Darin eingelagert sind nach Nordosten hin einzelne kräftige Gewitter mit
stündlichen Niederschlagssummen über 10 mm. Auch über Oberbayern hat es sich in einer Linie Donau-München-Karwendel
eingeregnet mit Stundensummen zwischen 6 und 10 mm. Bis Sonntagmorgen werden in der Südosthälfte weitere ergiebige Regenfälle
erwartet. Der Schwerpunkt wird erneut in einem Streifen vom Thüringer Wald und Erzgebirge bis zum Bayerischen Alpenrand verlaufen.
Prognostizierte Niederschlagssummen ausgewählter Modelle sind in den angehängten Grafiken zu finden.
Detaillierte Warnungen erfolgen im
Warnlagetext.
Bilder
Information on warning levels and icons used
Information on meteoalarm.eu
|

