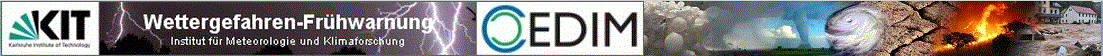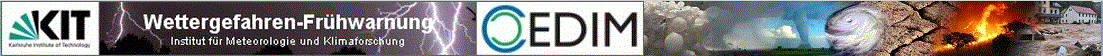Wetterlage und Entwicklung
Nach zwei überaus wechselhaften und kühlen Monatsdritteln setzte sich in Deutschland erst in der letzten Junidekade
2009 wenngleich nicht beständiges, so doch immerhin sommerlich warmes Wetter durch. Unter dem Strich reichte es vor allem in
der Nordosthälfte des Landes jedoch nicht mehr zu einer positiven Temperaturabweichung im Vergleich zu den klimatologischen
Mittelwerten der Jahre 1961 bis 1990. Das Schlusslicht bildete der Flughafen Dresden, wo 1,5 K zu einem durchschnittlichen
Junimonat fehlten (+15,0 °C). Im Südwesten dagegen war der Monat am Ende doch noch etwas zu warm (z. B. Stuttgart
+16,5 °C / +0,8 K). Vor allem im Südosten verlief der Juni deutlich zu nass, was in erster Linie einem
Dauerregenereignis in der letzten Dekade geschuldet war. Am Münchner Flughafen fielen 166,5 mm Niederschlag und damit gut
anderthalb Mal so viel wie im Juni normalerweise üblich. Sonst wurden durch kräftige Gewitter am Monatsende örtlich hohe
Summen erreicht, vielerorts war es aber zu trocken. Auf Helgoland beispielsweise kamen 31,5 mm und damit nur rund die Hälfte
des Monatssolls zusammen. Trotz der vielfach wechselhaften Witterung zeigte sich die Sonnenscheinbilanz weitestgehend
ausgeglichen. Richtung Südwesten schien die Sonne dabei oftmals etwas länger (z. B. Saarbrücken 261,3 Stunden / 122
Prozent), nach Osten hin dagegen nicht ganz so lange wie im Mittel (z. B. Dresden 147,3 Stunden / 73 Prozent).
Mit einer Monatsmitteltemperatur von +17,6 °C schnitt der Juni in Rheinstetten etwas zu warm ab (+0,6 K). Die
Gesamtniederschlagsmenge belief sich nur auf 56,7 mm - damit war der Juni hier der dritte zu trockene Monat in Folge
(63 Prozent). Die Sonnenscheindauer von 238,6 Stunden bewegte sich im Rahmen des für Juni zu erwartenden (112 Prozent). Eine
ausführlichere Betrachtung mit sämtlichen Tageswerten der Station gibt
es hier.
 |
01.06., 05:04 UTC, NOAA-15 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen zumindest im Norden Deutschlands zum meteorologischen Sommerbeginn
am 1. täuschten darüber hinweg, dass die großräumige Zirkulation einen Einbruch kalter
Luftmassen polaren Ursprungs nach Mitteleuropa und damit eine verfrühte Schafskälte vorbereitete. Dabei lag Mitteleuropa
zunächst im Einflussbereich eines umfangreichen Höhentiefkomplexes, der zwei Zentren über Osteuropa und den Westalpen
aufwies. Hohes Geopotential erstreckte sich von der Iberischen Halbinsel über die Britischen Inseln und Südskandinavien
nach Russland. Dabei bestimmte in der Südosthälfte Deutschlands um das östliche Höhentiefzentrum herumgeführte feuchte
Warmluft das Wetter. Kurze Schauer traten allerdings nur in einem Streifen zwischen dem Saarland und Brandenburg sowie
im Westen Nordrhein-Westfalens auf, sonst blieb es trocken.
Am 2. und 3. gliederte sich das kleine Höhentief über den Alpen
dem osteuropäischen Höhentiefzentrum an; beide zusammen wurden in einen von Nordwesten vorstoßenden Langwellentrog
integriert. Auf der Vorderseite dieses Troges entstand über dem Baltikum ein kräftiges Tiefdruckgebiet
("Isaak"), dessen Kaltfront Deutschland rasch von Nord nach Süd überquerte. Damit verbunden war ein markanter
Temperaturrückgang. Wurde beispielsweise in Potsdam am 2. noch eine Höchsttemperatur von
+26,1 °C gemessen, waren es einen Tag später nur noch +14,6 °C. Die Front an sich gab sich nur durch einige
- vornehmlich hohe - Wolkenfelder zu erkennen, Regen fiel an ihr nicht.
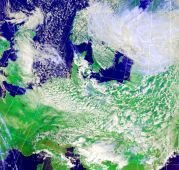 |
04.06., 12:09 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
Am 4. und 5. überdeckte der Langwellentrog ganz Nord- und weite
Teile Osteuropas. Demgegenüber stand ein von Nordalgerien über die Biskaya bis nach Südgrönland reichender und vor allem
in seinem Südteil zunehmend schmäler werdender Rücken. Am Boden schwächte sich Tief "Isaak" nur langsam ab. In
der Nähe zur höhenkältesten Luft - im 500-hPa-Niveau wurden zeitweise Temperaturen von unter -30 °C
analysiert - entwickelten sich im Norden Deutschlands einige Schauer, im äußersten Nordosten auch kurze Gewitter. In
der Südwesthälfte herrschte dagegen überwiegend heiteres und trockenes Wetter. Die Temperaturen freilich erinnerten
mehr an Frühherbst denn an Spätfrühling: Lediglich im Südwesten wurden tagsüber immerhin zwischen +15 °C und
+20 °C gemessen, im Norden meist nur +10 °C bis +15 °C. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge blieb es bei
einstelligen Werten, der Brocken im Harz (1142 Meter) meldete am 5. sogar Schneeschauer. In
der Nacht zum 6. konnte in Gardelegen (Schleswig-Holstein) ein neuer Junirekord der
Tiefsttemperatur verzeichnet werden - dort sank das Quecksilber bis auf -0,7 °C. Besonders in dieser Nacht wurde in
der Mitte und im Norden großflächig Bodenfrost registriert, Luftfrost gab es außer in Gardelegen beispielsweise noch in
Quickborn (Schleswig-Holstein, -0,3 °C) und Genthin (Sachsen-Anhalt, -0,3 °C). Die verfrühte Schafskälte 2009
ist Thema dieses Artikels.
Zum 6. stellte sich die Großwetterlage erneut um. Der "Hals" des westeuropäischen
Rückens wurde endgültig durchschnitten, der von Südwesten heranschwenkende Trog vereinte sich bei den Britischen Inseln
mit einem markanten Randtrog des nordeuropäischen Langwellentroges. Innerhalb von zwei Tagen wandelte sich die Nordlage
über Mitteleuropa so zu einer zyklonalen Südwestlage um. Auf der Vorderseite des südlichen Trogteils zog
am 6. Tief "Jürgen" von Frankreich über die Mitte Deutschlands hinweg nach
Osten. In erster Linie massive Warmluftadvektion löste großräumige Hebungsprozesse und damit verbreitet Niederschläge
aus, die sich auf die Mitte und den Süden konzentrierten. Innerhalb von zwölf Stunden bis 18 UTC fielen zum Beispiel in
Kempten (Allgäu) 20 mm.
Am 7. folgte auf "Jürgen" Tief "Klaus" und mit ihm der nördliche Trogteil
nach. Dabei entwickelten sich im Süden schon am frühen Nachmittag, am Abend dann auch im Westen und in der Mitte
Deutschlands Gewitter. Im Norden von Köln trat dabei sogar ein Tornado auf, der mehrere Dächer abdeckte und Bäume
entwurzelte.
|
Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD
|
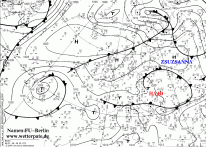 |
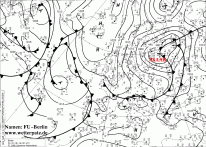 |
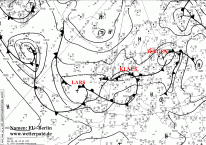 |
| 01.06.2009, 00 UTC |
04.06.2009, 00 UTC |
08.06.2009, 00 UTC |
|
850-hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale
|
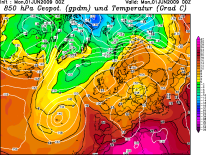 |
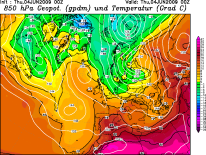 |
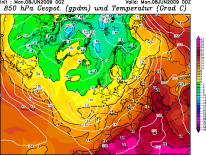 |
| 01.06.2009, 00 UTC |
04.06.2009, 00 UTC |
08.06.2009, 00 UTC |
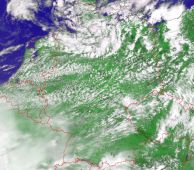 |
08.06., 11:23 UTC, NOAA VIS
Quelle: DLR |
Die Südwestlage hatte auch danach Bestand. Nach "Klaus" machte sich am 8. nur kurz
Zwischenhocheinfluss bemerkbar, ehe noch am Abend mit der Warmfront des vom Atlantik heranziehenden Tiefs
"Lars" im Südwesten bereits wieder Regen einsetzte. Bis zum 10. verlagerte sich
"Lars" über die Nordsee nach Südskandinavien, seine Kaltfront überquerte Deutschland
am 9. mit verbreiteten Regenfällen. Im Nordosten und später - mit Einströmen der
Höhenkaltluft - im Westen gab es auch Gewitter; in Lindenberg (Brandenburg) fielen 19 mm innerhalb von zwölf Stunden
bis 18 UTC.
Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Dekade wiederholte sich das Spiel: Am 10. bewegte sich
ein Zwischenhochkeil rasch über Mitteleuropa ostwärts, in der mittleren und oberen Troposphäre war jedoch nur ein schwacher
Rücken zu erkennen. Während im Norden und in der Mitte Deutschlands bei Temperaturen um +20 °C noch einzelne Schauer
fielen, behauptete sich im Süden oftmals die Sonne. In Regensburg wurden dabei +24,6 °C gemessen. Doch wiederum noch
am Abend griff das Frontensystem von Tief "Martin" mit Regen und einzelnen Gewittern auf den Westen des Landes
über. "Martin" zog am 11. über Norddeutschland hinweg zur Ostsee und wies an seiner
Süd- und Westflanke einen ansprechenden Druckgradienten auf. Es handelte sich um ein ausgewachsenes frühsommerliches
Sturmtief, auf dem Feldberg im Schwarzwald wurden in Böen sogar 130 km/h und damit voller Orkan registriert. Doch auch
in Rostock (104 km/h) und Berlin (94 km/h) blies der Wind in Böen mit Stärke 11 bzw. 10. Dazu fiel reichlich Regen. Die
um den Tiefkern gewundene Okklusion beeinflusste den Norden Deutschlands auch noch am 11.,
sodass dort entsprechend die höchsten 48-stündigen Summen zusammenkamen; in Teilen Schleswig-Holsteins über 50 mm
(z. B. Schönhagen 52 mm bis zum 12., 06 UTC). Auch im Süden Deutschlands traten
am 11. noch einige Schauer auf, insgesamt überwogen dort aber die heiteren Abschnitte. Mehr
zu Sturmtief "Martin" findet sich in einer separaten Analyse.
 |
12.06., 12:26 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
Am 12. und 13. wölbte sich über Westeuropa ein Hochdruckrücken
auf, der vorderseitige Druckanstieg am Boden resultierte in Hoch "Anja" mit Schwerpunkt über den Alpen. Während
in der Nähe von Tief "Martin" am 12. in der Nordosthälfte der Bundesrepublik weitere
Schauer niedergingen, breitete sich von Südwesten her zunehmend heiteres und sonniges Wetter aus. Die kräftige
Sonneneinstrahlung ließ die Temperaturen allmählich steigen, am Oberrhein tauchten am 13.
örtlich sommerliche Werte auf (z. B. Lahr +25,1 °C). An diesem Tag schien in nahezu ganz Deutschland die Sonne bei
nur wenigen Wolken.
Doch die Hochdruckphase war nur von kurzer Dauer. Die Warmfront eines Tiefs ("Nikolai") bei den Britischen
Inseln bescherte dem Nordwesten Deutschlands am 14. viele Wolken und etwas Regen. Die
zugehörige Kaltfront erstreckte sich in nahezu höhenströmungsparalleler Lage quer über den Südwesten Europas hinweg und
wies so zum einen kaum eine Verlagerungstendenz nach Südosten auf und neigte andererseits zur Ausbildung von Wellen. Die
erste dieser Wellen zog als recht flaches Gebilde am 14. etwa über die Mitte Deutschlands
nordostwärts und brachte zum Abend auch dem Süden gebietsweise etwas Regen sowie einzelne Gewitter. Vor allem in Südhessen
fielen die Gewitter auch kräftiger aus.
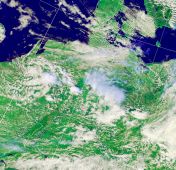 |
16.06., 11:48 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
Am 15. folgte eine weitere Welle nach, die unter die Vorderseite eines von Westen
nachrückenden, markanten Troges geriet und sich dadurch später über Osteuropa zu einem eigenständigen Tief
("Odin") intensivieren konnte. Gleichwohl erhielt die noch in der Entwicklung begriffene Welle diesen Namen
schon zwei Tage zuvor. In Verbindung mit "Odin" regnete es verbreitet kräftig. Durch eingelagerte konvektive
Prozesse unterstützt meldete zum Beispiel das thüringische Schleiz 49 mm binnen 24 Stunden bis
zum 16., 06 UTC. Eine ausführliche Betrachtung der Ereignisse rund um Tief
"Odin" liefert folgender Artikel.
Nach einem dank Hoch "Barbeleis" in ganz Deutschland sonnigen 17. mit einem
Temperaturgefälle von Südwest (z. B. Rheinstetten +26,3 °C) nach Nordost (z. B. Greifswald +18,2 °C) drang
am 18. die nächste Kaltfront südostwärts vor. Sie gehörte zu einem Tiefdrucksystem
("Peter") über dem Nordmeer und Südskandinavien. Der zugehörige Höhentrog griff erst
am 19. von Nordwesten her auf Mitteleuropa über, sodass die Front zunächst quer über der
Mitte Deutschlands liegen blieb. Dort fiel aus dichter Bewölkung zeitweise etwas Regen, während südlich der Donau in
der zuvor eingeströmten Warmluft kräftige Schauer und einzelne Gewitter ausgelöst wurden (z. B.
Leutkirch-Herlazhofen / Allgäu 36 mm in sechs Stunden bis zum 19., 06 UTC).
|
Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD
|
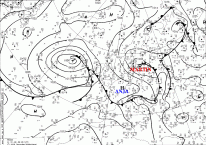 |
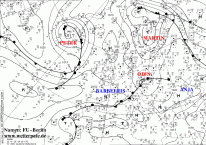 |
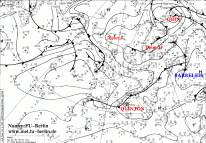 |
| 12.06.2009, 00 UTC |
16.06.2009, 00 UTC |
20.06.2009, 00 UTC |
|
850-hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale
|
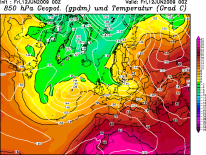 |
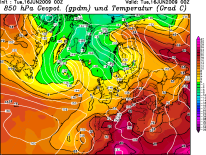 |
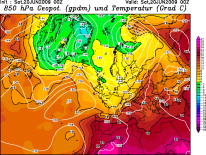 |
| 12.06.2009, 00 UTC |
16.06.2009, 00 UTC |
20.06.2009, 00 UTC |
 |
20.06., 12:43 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
Bis zum 20. hatte sich mit einer nordwestlichen Strömung hochreichend kalte Luft polaren
Ursprungs in ganz Mitteleuropa durchgesetzt. Ein an der Westflanke des Troges südostwärts laufender Randtrog weitete
den Haupttrog in seinem Südteil bis ins zentrale Mittelmeer aus. In ganz Deutschland herrschte eingangs der letzten
Dekade - zum kalendarischen Sommeranfang - somit wechselhaftes Schauerwetter, auch einzelne Gewitter waren mit von der
Partie. Die Temperaturen wurden der Jahreszeit nicht gerecht und erreichten Höchstwerte von gerade einmal +15 °C
und +20 °C - lediglich am Oberrhein auch etwas mehr (z. B. Rheinstetten +20,5 °C
am 21.
Noch am 21. wanderte innerhalb des Höhentroges ein kleines Höhentief von Nord nach Süd
über Deutschland hinweg und passierte am 22. die Alpen. Im Süden gingen weitere Schauer
nieder, im Norden machte sich Hoch "Corina" mit vermehrten heiteren Abschnitten bemerkbar.
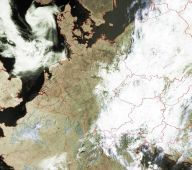 |
24.06., 09:47 UTC, NOAA-17 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
Während von Westeuropa über die Britischen Inseln und Südskandinavien bis nach Nordwestrussland in der Höhe das
Geopotential stieg und sich am Boden eine ausgeprägte Hochdruckzone mit dem Schwerpunkt in "Corina" etablierte,
nistete sich der ehemalige Trog als umfangreiches Höhentief über Südosteuropa ein. Am Boden bildete sich in seinem
Bereich Tiefdruckgebiet "Qinton" aus. Um Boden- und Höhentief herum wurde in einem großen Bogen über das
östliche Mittelmeer und das Schwarze Meer Warmluft gelenkt, die sich über dem Wasser mit Feuchtigkeit anreichern
konnte. Die massive Warmluftadvektion führte zu großräumigen Hebungsprozessen und intensiven Niederschlägen im
östlichen Alpenraum. Davon betroffen war vor allem am 23. und 24.
auch der Südosten Bayerns. In Inzell (Landkreis Traunstein) fielen innerhalb von drei Tagen 157 mm. Zahlreiche kleinere
Flüsse traten über die Ufer. Von der Zugspitze wurden am Morgen des 23. 60 cm Neuschnee
gemeldet - soviel wie in einem Juni seit elf Jahren nicht mehr. Im Nordwesten bekam man von alldem wenig mit - dort
schien bei am 24. häufig sommerlichen Temperaturen (z. B. Düsseldorf/Flgh. +25,8 °C)
ausgiebig die Sonne. Mehr zu den ergiebigen Niederschlägen im Südosten Bayerns und im östlichen Alpenraum gibt
es hier.
Zwischen dem mächtigen Hoch im Norden und dem Tief über Südosteuropa erfasste die warme Luft aus Osten zum Ende des
Monats ganz Mitteleuropa. Doch die Luft war nicht nur warm, sondern auch sehr feucht. Auf der Vorderseite eines
atlantischen Tiefdruckgebietes gelangte zudem auch von Südwesten her feuchtwarme Luft nach West- und in Teile
Mitteleuropas. Verbreitet stellte sich sommerliches Wetter mit hohen Temperaturen, gleichzeitig aber auch hoher
Luftfeuchtigkeit und dementsprechender Schwüle ein. Lediglich in den Norden Deutschlands strömte am Rande des
nordeuropäischen Hochs trockenere Luft. Während dort ausnahmslos die Sonne schien, entwickelten sich in den übrigen
Regionen jeweils im Tagesgang zum Teil kräftige Gewitter. Am 25. waren davon nur der
äußerste Osten und der Südwesten betroffen, am 26. der Osten Bayerns sowie die Bereiche
südwestlich einer Linie Essen - Ulm. Die 24-stündigen Niederschlagsmengen bis zum Morgen
des 27. reichten dabei bis 72 mm im bayerischen Attenkam (Landkreis
Bad Tölz-Wolfratshausen).
 |
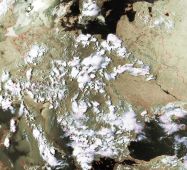 |
28.06., 12:53 UTC, NOAA VIS
Quelle: DLR |
30.06., 14:54 UTC, NOAA-15 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
Bis zum Ende des Monats blieb die Großwetterlage in ihren Grundzügen bestehen. Im Norden wurde Hoch
"Corina" von Hoch "Diana" abgelöst, über Südosteuropa schwächte sich das Höhentief nur allmählich
ab. Bei nur geringen Luftdruckgegensätzen über Mitteleuropa verlagerten sich einmal entstandene Gewitterzellen äußerst
langsam und brachten lokal große Regenmengen. Während die Gewittertätigkeit am 28. im
Bereich eines kurzzeitig von Südwesten her vorstoßenden Rückens fast zum Erliegen kam, lebte sie
am 29. und 30. wieder deutlich auf. Dabei kristallisierten
sich zwei Zonen mit gesteigerter Aktivität heraus: Zum einen im Westen vom Schwarzwald bis nach Nordrhein-Westfalen
und zum anderen im äußersten Osten von Bayern bis nach Brandenburg. In Mannheim beispielsweise kamen am Nachmittag
des 30. innerhalb von sechs Stunden 45 mm Regen zusammen. Eine chronologische
Zusammenfassung der Gewitterereignisse ab dem 25.
kann hier abgerufen werden.
|
Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD
|
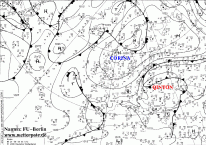 |
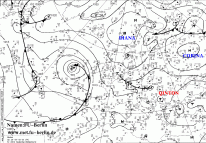 |
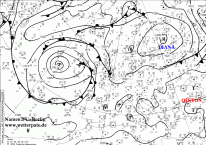 |
| 24.06.2009, 00 UTC |
28.06.2009, 00 UTC |
30.06.2009, 00 UTC |
|
850-hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale
|
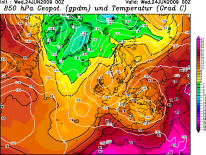 |
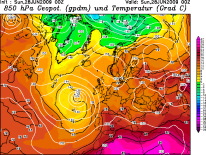 |
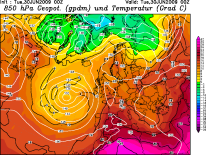 |
| 24.06.2009, 00 UTC |
28.06.2009, 00 UTC |
30.06.2009, 00 UTC |
Monatswerte
Nachstehend Monatswerte vom Juni 2009 für ausgewählte Stationen in Deutschland.
"Temp." steht dabei für die Monatsmitteltemperatur, "Nds." für die Niederschlagssumme
und "Sonne" für die Sonnenscheindauer. "Vgl." gibt für die jeweilige Größe den Vergleich
mit dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 des Ortes an (Quelle: DWD):
| Ort |
Temp. |
Vgl. |
Nds. |
Vgl. |
Sonne |
Vgl. |
Schwerin
Konstanz
Rheinstetten |
+14,2 °C
+17,1 °C
+17,6 °C |
-1,3 K
+0,8 K
+0,6 K |
39,3 mm
96,8 mm
56,7 mm |
61%
92%
63% |
220,6 h
221,1 h
238,6 h |
97%
101%
112% |
|
Text und Gestaltung: CE

|
|
In Zusammenarbeit mit:
|

|
|