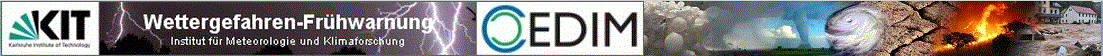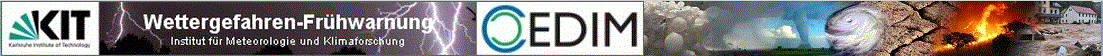Zu warm, zu trocken, zu sonnig - die Kurzzusammenfassung des März 2011
lässt sich für viele Orte in Deutschland inklusive dem Raum Karlsruhe
eins zu eins auch auf den April übertragen. Mit einem über die gesamte
Fläche der Bundesrepublik gemittelten Temperaturüberschuss von 4,4 K
gegenüber dem klimatologischen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 trägt
sich der vierte Monat des laufenden Jahres knapp hinter 2009 und noch
vor 2007 als zweitwärmster April seit Messbeginn im Jahre 1881 in die
Geschichtsbücher ein. Unter den Top-10 beziehungsweise Top-5 findet man
den Monat hinsichtlich Trockenheit und Sonnenscheindauer. Letztere
erreichte unter anderem in Rheinstetten einen imposanten Wert: Mit 280
Stunden schien die Sonne hier fast doppelt so lange wie in einem April
zu erwarten; sogar der Mittelwert des sonnenscheinreichsten Monats Juli
von 237,5 Stunden wurde damit deutlich übertroffen.
Zumindest in punkto Wärme startet der Mai nun aber deutlich verhaltener
als sein Vorgänger. Dies liegt an einer nordöstlichen Strömung, die
sich am Rande eines große Teile des nordwesteuropäischen Raumes
umfassenden Hochdruckgebietes mit Schwerpunkten bei Nowaja Semlja, über
dem Nordmeer und über der Nordsee am Montag bereits über fast ganz
Deutschland eingestellt hat. Lediglich der äußerste Süden verblieb noch
im Bereich der alten und feuchten Warmluftmasse, in der sich an den
vergangenen Tagen in schöner Regelmäßigkeit Schauer und Gewitter
entwickelten. Im Nordosten dagegen kamen die Temperaturen in der dort
eingeflossenen Kaltluft polaren Ursprungs kaum noch über +10 Grad
hinaus. Der Hochdruckzone östlich gegenüber steht ein ausgeprägtes
Höhentief, dessen Dreh- und Angelpunkt über der westlichen Ostsee
ausgemacht werden kann. Sein Einfluss reicht bis nach Mitteleuropa und
spiegelt sich unter anderem in einem scharfen Randtrog wider, der in
der Nacht zum Dienstag ostsüdostwärts über das Bundesgebiet
hinwegschwenkt. Seine Wetterwirksamkeit bleibt im Norden gering; im
Süden allerdings sorgen die auf seiner Vorderseite wirksamen
dynamischen Hebungsprozesse für die Entstehung eines ausgedehnten und
in der zumindest teilweise noch potentiell instabil geschichteten
Luftmasse mit Schauern und örtlichen Gewittern durchsetzten
Regengebietes. Im Zusammenspiel mit einem nordostwärts ziehenden
Mittelmeertief, das sich rinnenförmig bis in den Süden und Osten
Deutschlands erstreckt, wird im Südosten vorübergehend
Warmluftadvektion wirksam. Dadurch kommen auch in Sachsen und Bayern
zum Teil länger anhaltende Niederschläge auf, die am Morgen im
Erzgebirge durchaus bis in mittlere Höhenlagen herab als Schnee fallen
können. Dazu frischt dort der Nordostwind bisweilen stürmisch auf. Zum
Abend folgt von der Nordsee her ein weiterer, allerdings weniger scharf
ausgeprägter Randtrog des mit seinem Zentrum unverändert über der
westlichen Ostsee verweilenden Höhentiefs nach. Immerhin kann sich
unter seiner Vorderseite ein flaches Tief entfalten, das am Mittwoch
über den Nordosten Deutschlands nach Polen zieht. Mit etwas Fantasie
kann man diesem ein schwach ausgeprägtes Frontensystem zuordnen, das
etwa entlang der Zugbahn zunächst leichte bis mäßige Regenfälle, später
einige Schauer hinterlässt. Im übrigen Land kommt der Einfluss der bis
dahin modifizierten nordwesteuropäischen Hochdruckzone zum Tragen,
deren südlicher Schwerpunkt allmählich nach Benelux wandert und sich an
der Ostflanke eines über Westeuropa aufsteilenden Rückens kräftigt.
Erwähnenswert sind dabei zunächst vor allem die Tiefsttemperaturen, die
in der Nacht zum Dienstag hauptsächlich im Norden, in der Nacht zum
Mittwoch vor allem Richtung Süden und in der Nacht zum Donnerstag
voraussichtlich verbreitet im leichten bis mäßigen Frostbereich und
mancherorts wohl in der Nähe der bisherigen Mairekorde liegen.
In der zweiten Wochenhälfte wird das nordosteuropäische Höhentief
regeneriert und tritt dann - zusammen mit dem sich weiter nach Süden
ausdehnenden Randtrog - mehr als langwelliger Höhentrog in Erscheinung.
Die gesamte Anordnung, bestehend aus Höhentrog und nachfolgendem
Rücken, verlagert sich insgesamt einige hundert Kilometer nach Osten,
sodass der Trog für das mitteleuropäische Geschehen an Bedeutung
verliert. Durch großräumiges Absinken auf der Vorderseite des Rückens
erwärmt sich die Luft zunächst zögernd, auf der Rückseite des
Deutschland passierenden Bodenhochs mit Drehung der Strömung auf
südliche Richtungen zum Wochenende hin rasch.
|