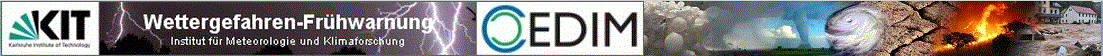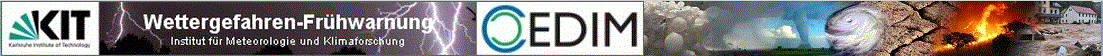Das erste frühsommerliche Wochenende liegt hinter Deutschland - und das
bereits Anfang April. An 18 von 119 Wetterstationen im ganzen Land
wurden am Samstag und Sonntag neue Temperaturrekorde für die erste
Aprildekade verzeichnet, an einigen davon zum Teil mehr als 50 Jahre
alte Rekorde gebrochen. Die absolut höchste Temperatur konnte an der
ehemaligen Station des Deutschen Wetterdienstes in der Karlsruher
Hertzstraße mit +26,9 Grad gemessen werden, gleichbedeutend mit der
Einstellung des Dekadenrekordes von 1961. Erst ein einziges Mal, 1989,
gab es in Karlsruhe zeitiger im Jahr einen Sommertag, also einen Tag
mit einer Höchsttemperatur von mindestens +25,0 Grad. Betrachtet man
die gesamte Zeitreihe seit 1876, lässt sich als mittleres Datum für den
ersten Sommertag der 7. Mai finden. Somit kam hier der Frühsommer -
wenn man so will - in diesem Jahr über einen Monat früher als
klimatologisch zu erwarten.
Und passend dazu gab es nicht nur Wärme, sondern am Sonntagabend im
Vorfeld einer Kaltfront auch einige kräftige Gewitter.
Niederschlagsmengen über 30 mm innerhalb von 24 Stunden wurden in
Malsburg-Marzell im Landkreis Lörrach und in Elzach-Fisnacht bei
Freiburg registriert. Am Montagvormittag regnete es südlich der Donau
noch kräftig, sonst entwickelten sich in der einfließenden
Meereskaltluft nur mehr einzelne Schauer. Die Kaltluft spiegelt sich im
Geopotentialfeld in zwei kurzwelligen Trogstrukturen wider, die sich in
der Nacht zum Dienstag über Mitteleuropa hinweg ostwärts verlagern. In
Bodennähe hat sich bereits am Montag von Südwesten her ein Keil des
Azorenhochs bis in den Südwesten Deutschlands vorgeschoben und dort das
Geschehen weitgehend beruhigt. Auf der Vorderseite eines über
Westeuropa entstehenden Hochdruckrückens geht aus dem Keil am Dienstag
eine eigenständige Hochdruckzelle hervor, deren zentraler Bereich dann
weite Teile Frankreichs, Süddeutschlands und den Alpenraum überdeckt.
In diesen Regionen erwärmt die Sonne die eingeflossene Kaltluft rasch
und führt die Temperaturen wieder an die +20-Grad-Marke heran. Den
Norden Deutschlands überquert dagegen die Okklusion eines Tiefs mit
Zentrum vor der Südspitze Grönlands beziehungsweise dessen Randtiefs
bei Island, die sich jedoch nur in Form einiger Wolken bemerkbar macht.
Ihr rasch nach folgt die Warmfront eines weiteren, zu dieser Zeit sich
ebenfalls bei Island befindlichen Randtiefs, die das Bundesgebiet in
der Nacht zum Mittwoch südostwärts passiert. Etwas Regen fällt in
diesem Zusammenhang im Norden und Nordosten. Die Kaltfront des
Randtiefs erreicht deutschen Boden nicht, sondern wird bereits über
Dänemark als Warmfront einer über die Britischen Inseln hinwegziehenden
Welle nach Nordosten rückläufig. Zum Mittwoch gerät Mitteleuropa in den
weit geöffneten Warmsektor dieser dann ebenso als Randtief zu
bezeichnenden Welle, wobei von Südwesten her erneut die Zufuhr
subtropischer Warmluft einsetzt. Zu der advektiven Erwärmung addiert
sich die Erwärmung infolge andauernden Absinkens auf der Vorderseite
des westeuropäischen Rückens.
Zum Donnerstag zieht das letztgenannte Randtief als dann eigenständige
Zyklone nach Nordskandinavien, seine Kaltfront streicht in der ersten
Tageshälfte über den Norden Deutschlands hinweg und erreicht
Freitagfrüh die Alpen. Dahinter strömt vor allem in den Norden und
Osten deutlich frischere Meeresluft ein, moderater fällt die Abkühlung
zunächst im Südwesten aus. Gegen Ende der Woche kommt Mitteleuropa
zwischen einem neuen Hoch bei den Britischen Inseln und einem
Tiefdrucksystem über dem Nordosten des Kontinents zum Liegen.
Naturgemäß profitiert insbesondere der Westen von der Nähe des Hochs,
während sich der Ablauf nach Nordosten hin voraussichtlich leicht
unbeständig gestaltet. Mit einer nordwestlichen bis nördlichen Strömung
wird es dann aber überall kühler.
|