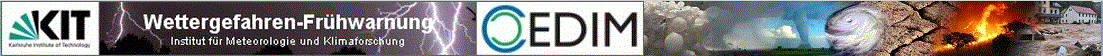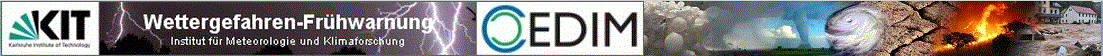Mit dem heutigen Montag endet in Meteorologenkreisen die winterliche
Jahreszeit, welche die Monate Dezember, Januar und Februar umfasst. In
der mitteleuropäischen Realität genügte die Witterung in dieser Saison
jedoch nur im Dezember winterlichen Ansprüchen, fielen die beiden
ersten Monate des neuen Jahres im deutschen Flächenmittel doch wärmer
als im langjährigen Durchschnitt aus. Die negative Abweichung des
Dezembers von 3,5 Kelvin wurde dabei zum Schluss fast noch egalisiert;
unter dem Strich bleibt ein Minus von 0,8 Kelvin, womit der Winter
2010/11 deutlich milder verlief als sein Vorgänger, der 1,5 Kelvin zu
kalt abschloss.
Nun also beginnt der meteorologische Frühling, der zu seinem Auftakt
zumindest sonnenscheintechnisch bereits aus dem Vollen schöpft. Dafür
verantwortlich zeichnen ein Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem
Ostatlantik und sein westrussisches Pendant, das im Rahmen dieses
Berichtes hiermit zum vierten Mal in Serie Erwähnung findet. Noch am
Montagfrüh lag ein kleines Tief mit seinem Zentrum über dem Norden
Deutschlands, es hat sich inzwischen jedoch aufgelöst. Somit steht
einer brückenartigen Verbindung der beiden Antizyklonen nichts mehr im
Wege, am Abend erstreckt sich diese über die Britischen Inseln, die
Nordsee und das südliche Skandinavien hinweg zum Baltikum und nach
Osteuropa. Gestützt wird die Hochdruckzone durch einen dieselben
Gebiete überdeckenden und damit quasi zonal ausgerichteten Rücken mit
einem gesonderten Schwerpunkt über der Ostsee. Dem ganzen steht ein
hochreichendes und vor allem in höheren Schichten ausgeprägtes Tief
über dem westlichen Mittelmeer gegenüber, das zusammen mit dem Hoch der
Strömung in Mitteleuropa eine östliche Komponente verleiht. Diese
Konstellation brachte am Montag besonders den mittleren Teilen
Deutschlands reichlich Sonnenschein, während im Nordwesten und im Süden
hochnebelartige Bewölkung dominierte. Im Nordwesten trat diese im
Bereich des sich abschwächenden Tiefs auf, während eine Zuordnung im
Süden schwerer fällt. Die Bewölkung dort dürfte in erster Linie
innerhalb der feuchten Grundschicht nach dem sonntäglichen Regen
entstanden sein, und weniger aufgrund Zufuhr feuchter Luft auf der
Vorderseite des südeuropäischen Tiefs. Am Dienstag und Mittwoch ändert
sich an der räumlichen Anordnung der bestimmenden Druckgebilde nur
wenig, allerdings kräftigt sich die Hochdruckzone in ihrem Mitteteil,
sprich über dem südskandinavischen Raum. Da sich das mit seinem Zentrum
dann über Sardinien und Korsika positionierte Tief kaum abschwächt,
verschärfen sich die Luftdruckgegensätze im Übergangsbereich dazwischen
deutlich. Insbesondere über dem Süden Deutschlands stellt sich eine
kräftige östliche Strömung ein, die in den Hochlagen der Mittelgebirge
schwere Sturm- oder orkanartige Böen hervorbringt. Hinsichtlich der
Temperierung der herangeführten Luftmasse lässt sich festhalten, dass
diese - verglichen mit winterlichen Ostlagen - nicht sonderlich kalt
ist. Das großräumige Absinken auf der Vorderseite des Rückens
kompensiert zudem teilweise die advektive Abkühlung.
Zum Ende der Woche verliert das russische Hoch und damit der östliche
Bestandteil der Brücke merklich an Kraft beziehungsweise Druck. Übrig
bleibt ein Hoch mit Schwerpunkt bei den Britischen Inseln, das aber
seinen Einfluss auf das Wettergeschehen in Mitteleuropa behält. Derweil
sammelt sich über dem Norden Europas hochreichend kalte Luft an, die im
Laufe des Wochenendes nach Süden vorstößt. Deutschland wird davon aller
Voraussicht nach aber nur im Osten gestreift.
|