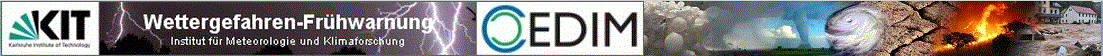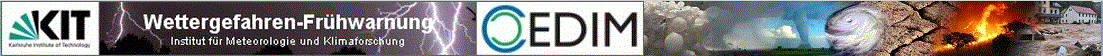Ein großes Tief in der Höhe und viele kleine am Boden beschäftigen seit
Freitag weite Teile Mitteleuropas. Ergiebige Regenfälle auf der einen,
kräftige Gewitter auf der anderen Seite führten vielerorts zu
erwähnenswerten Niederschlagsmengen, die ob ihrer Anzahl an dieser
Stelle nicht allesamt aufgeführt werden können. Ein paar Highlights, so
man sie denn als solche bezeichnen will, sollen trotzdem genannt
werden. Jeweils innerhalb von zwölf Stunden fielen in Mondovi/Italien
81 mm und in Malmö/Schweden 55 mm bis Samstagabend, in Bern/Schweiz 75
mm bis Sonntagfrüh, in Bendorf bei Koblenz 42 mm bis Sonntagabend und
in Gent/Belgien 61 mm bis Montagfrüh. Eine bunte Ansammlung
europäischer Stationen, die sich zwar nicht beliebig, aber um einiges
erweitern ließe - auch mit Blick auf das, was da in den nächsten 24
Stunden noch bevorsteht.
Am Montagabend lassen sich drei verschiedene Niederschlagsschwerpunkte
mit unterschiedlicher Genese über Mitteleuropa ausmachen. Zum einen ein
von der französisch-belgischen Küste bis zur Schweiz reichendes
Regenband, das die um das Zentrum eines über Belgien liegenden
Bodentiefs gewundene Okklusion markiert. Über Belgien, den Niederlanden
und bis zur Mitte Deutschlands findet sich ein Gebiet mit
schauerartigen Regenfällen, das seine Entstehung dynamischen
Hebungsprozessen vor einem um das mit seinem Kern über
Nordostdeutschland gelegene Höhentief schwenkenden Randtrog verdankt.
Zuletzt wäre ein Gewittercluster zu nennen, der von Süden her kommend
bereits die Mitte Polens erreicht hat und sich weiter nach Nordwesten
bewegt. Dieser entstand - wie am Wochenende bereits die Gewitter im
Osten Deutschlands - im Bereich äußerst labil geschichteter Warmluft,
die an der Ost- und Nordflanke eines am Samstag nordwärts über die
Alpen gezogenen Tiefs nach Norden und Westen gelenkt wurde. Aufgleiten
dieser Warmluft auf kühlere Luft in den unteren Schichten hatte und hat
die flächendeckenden Regenfälle im Westen zur Folge. Am Dienstag
verschiebt sich das Höhentief etwas nach Norden, das an der
westdeutschen Grenze gelegene Bodentief wandert zur Nordsee und löst
sich allmählich auf. An seine Stelle tritt quasi das mit dem
Gewittercluster über dem östlichen Mitteleuropa in Zusammenhang
stehende Bodentief, das um das Höhentief herum über die Ostsee nach
Dänemark zieht. Auf der Südseite von (neuem) Boden- und Höhentief
stellt sich über Deutschland eine sowohl in der unteren als auch in der
mittleren und oberen Troposphäre stramme Westströmung ein, mit der die
um das (alte) Bodentief gewundene Okklusion samt des zugehörigen
Regengebietes über Deutschland hinweg nach Osten geführt werden. Da es
sich ursprünglich um die äußerst labil geschichtete Warmluft aus dem
südosteuropäischen Raum handelt, fallen die Niederschläge teilweise
schauerartig verstärkt und örtlich gewittrig. Somit muss gebietsweise -
vor allem in Nordrhein-Westfalen - noch einmal mit größeren Regenmengen
gerechnet werden. Erst am Mittwoch schwächt sich der Tiefkomplex über
Südskandinavien soweit ab, dass er keinen nennenswerten Einfluss mehr
auf das Wettergeschehen in Deutschland ausübt. Dieser geht dann von
einem neuen hochreichenden Tief bei den Britischen Inseln aus, dessen
bis dahin gealterte Okklusion auf ihrem Weg über Deutschland hinweg
ostwärts zwar noch gebietsweise, längst aber nicht mehr soviel Regen
bringt wie das gegenwärtige System.
Die angesprochene Okklusion geht in der zweiten Wochenhälfte in eine
wenig wetterwirksame Luftmassengrenze über, die am Donnerstag über
Süddeutschland verläuft und zum Freitag vor einem weiteren Tief bei den
Britischen Inseln als Warmfront nach Nordosten rückläufig wird.
Dahinter strömt von Südwesten her vor allem Richtung Wochenende
deutlich wärmere - jedoch auch feuchte - Luft nach Mitteleuropa, in der
in den dafür prädestinierten Regionen auch in Deutschland örtlich
hochsommerliche Temperaturen in den Bereich des Möglichen rücken.
|