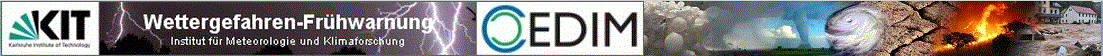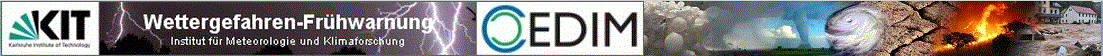Katastrophale Ausmaße nahm am Samstag ein Unwetter auf der
portugiesischen Ferieninsel Madeira an. Durch Sturzfluten und
Erdrutsche kamen mindestens 42 Menschen ums Leben, weit über 100 wurden
verletzt. Betroffen war in erster Linie der Südteil der gebirgigen
Insel rund um die Hauptstadt Funchal, wo zusätzlich Staueffekte zu den
intensiven Regenfällen beitrugen und diese verstärkten. Auf dem Pico do
Arieiro, mit 1.818 Metern der dritthöchste Berg Madeiras, fielen 165 mm
innerhalb von nur fünf Stunden zwischen 06 und 11 UTC. In Funchal
selbst waren es im selben Zeitraum 108 mm; dort fallen sonst im
gesamten Monat Februar nur 68 mm. Die Hauptursachen dieser Katastrophe
sind in einer vulkanischen und daher nur wenig wasserdurchlässigen
Bodenschicht in Verbindung mit hoher Reliefenergie und damit großen
Abflussmengen zu suchen, die durch eine übermäßige Verbauung der großen
Abflusssysteme zu einem gewissen Teil aber auch "hausgemacht" war.
Das für die Unwetter auf Madeira verantwortliche Tiefdruckgebiet liegt
am Montagabend mit seinem Zentrum über Benelux. Hinter der zugehörigen
Warmfront gelangt von Südwesten her sehr milde Luft nach Mitteleuropa,
die am Nachmittag das Thermometer bis auf vorfrühlingshafte +15,2 °C in
Freiburg steigen ließ. Rheinstetten verzeichnete mit einem Maximum von
+13,5 °C die höchste Temperatur seit Ende November 2009. Dagegen
erweist sich der Winter im Norden Deutschlands als zäh - dort fielen in
der Nacht zum Montag nochmals einige Zentimeter Neuschnee (z. B.
Hamburg/Flgh. 7 cm), ehe im Tagesverlauf leichtes Tauwetter einsetzte.
Zusammen mit dem Tiefkern am Boden schwenkt in der Nacht zum Dienstag
ein kurzwelliger Höhentrog über den Norden Deutschlands nordostwärts.
Dieser initiiert einerseits großräumige Hebungsvorgänge; zum anderen
trägt dazu auch eine scharfe Konvergenzzone in Bodennähe bei, die sich
durch die lang gezogene, rinnenartige Struktur des Tiefs mit
nordöstlichen Winden auf dessen Nord- und südwestlichen Winden auf der
Südseite ergibt. Diese Zone markiert gleichzeitig die Grenze zwischen
der winterlichen Kaltluft über Nordeuropa und der von Südwesten
einströmenden, deutlich milderen Luft. Dabei haben meist mäßige
Regenfälle bereits auf Norddeutschland übergegriffen, in
Schleswig-Holstein - also in dem Bereich nördlich des Tiefzentrums mit
nordöstlichen Bodenwinden - fällt auch Schnee. Nach Abzug von Trog und
Tief und den damit verbundenen Niederschlägen macht sich am Dienstag
schwacher Zwischenhocheinfluss bemerkbar. Ein wirkliches Hoch oder ein
Keil lässt sich wahrlich nur schwer analysieren; eher handelt es sich
um ein Gebiet erhöhten Luftdrucks zwischen dem dann über der Ostsee
angelangten Tief und einer weiteren, kräftigen Zyklone mit Zentrum vor
der Biskaya. Entsprechend gestalten übergeordnete Prozesse in Form von
in die südwestliche Höhenströmung eingelagerten Kurzwellentrögen das
Wettergeschehen weiterhin unbeständig. Rückseitig des Ostseetiefs
verlagert sich die Luftmassengrenze vorübergehend etwas nach Süden,
wird aber auf der Vorderseite des Tiefs vor Westeuropa zum Mittwoch
wieder nach Norden rückläufig. Gebietsweise maximierte
Warmluftadvektion sowie weitere Kurzwellentröge sorgen auch im
Zusammenhang mit diesem neuen Tief für Niederschläge. Im äußersten
Norden fällt weiterhin Schnee, dort gelingt der Luftmassenwechsel noch
nicht.
Unter allmählicher Abschwächung und Auflösung bewegt sich das Tief am
Donnerstag Richtung südliche Nordsee und Norddeutschland - gefolgt von
einem weiteren, sich vor Südwesteuropa entwickelnden und einen
ähnlichen Kurs einschlagenden Tief, dessen Fronten Deutschland
voraussichtlich zwischen Donnerstag- und Freitagabend überqueren. Dann
wird auch im Norden des Landes die alte Kaltluft durch deutlich mildere
Luft ersetzt. Zum Wochenende ändert sich nur wenig an der zwar milden,
insgesamt aber wechselhaften Südwestwetterlage mit wiederholt
auftretenden Niederschlägen, die bis in hohe Lagen als Regen fallen.
|