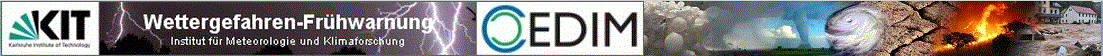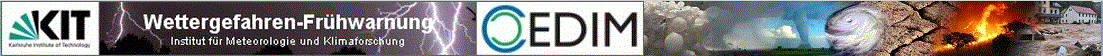Während sich im Nordosten Deutschlands das sonnige, warme und in erster
Linie trockene Aprilwetter auch in den nächsten Tagen ohne größere
Einschränkungen fortsetzt, werden die Abstände zwischen den
wechselhaften Witterungsphasen in der Südwesthälfte allmählich kürzer.
Rund eine Woche nach den ergiebigen Regenfällen in Teilen West- und
Süddeutschlands, bei denen an manchen Stationen innerhalb von nur 48
Stunden das Monatsniederschlagssoll erfüllt wurde, steht diesen Gebieten
am Dienstag und Mittwoch erneut eine Dauerregenlage bevor. Trotz
ähnlicher Großwetterlage werden so hohe Mengen wie vor Wochenfrist
diesmal jedoch voraussichtlich nicht erreicht. Anders stellt sich die
Situation dagegen in Südfrankreich, Oberitalien und den Südalpen dar.
Beispielsweise fielen auf Porquerolles, einer kleinen französischen
Insel im Mittelmeer unweit von Toulon, bis Montag Morgen 77 mm Regen in
nur zwölf Stunden. In Evolène, einer etwas mehr als 1.500 Einwohner
zählenden Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin in knapp 1.400 Meter Höhe,
schneite es kräftig - zwischen Montag Morgen und Abend stolze 43 cm. Bis
Mittwoch muss in diesen Regionen mit weiteren 50 bis 100 mm Niederschlag
gerechnet werden, örtliche Überschwemmungen und inneralpine Murenabgänge
inklusive.
Großräumige Hebungsvorgänge auf der Vorderseite eines langwelligen
Höhentroges, der sich im Ganzen vom Nordmeer über die Britischen Inseln
bis zum zentralen Mittelmeer erstreckt, haben im Laufe des Montags über
dem Golf von Genua am Boden ein Tiefdruckgebiet entstehen lassen. Es
bildet das südliche Ende einer längs über Mitteleuropa respektive die
Mitte Deutschlands verlaufenden Tiefdruckrinne. Darin eingebettet lässt
sich eine Luftmassengrenze analysieren, die warme und trockene Luft im
Osten von deutlich kühlerer und feuchter Luft im Westen trennt. Doch
eine Luftmassengrenze allein muss nicht zwangsläufig markante
Wettererscheinungen hervorbringen; häufig bedarf es dazu einer
Aktivierung, die am Dienstag in Form eines kurzwelligen Höhentroges
gegeben ist. Dieser schwenkt an der Ostflanke eines umfangreichen
Höhentiefs über die Westhälfte Deutschlands hinweg nordwärts. Das
Höhentief, unter dem sich auch in Bodennähe ein Tief befindet,
regeneriert den Langwellentrog von Nordwesten her und bewegt sich mit
seinem Zentrum von den Britischen Inseln nach Nordfrankreich. Das zu dem
Bodentief gehörende und bereits weitestgehend okkludierte Frontensystem
kommt langsam ostwärts voran, wobei die beiden Niederschlagsgebiete -
das an der Luftmassengrenze entstehende zum einen und das der Okklusion
zum anderen - über Ostfrankreich und dem Westen Deutschlands ineinander
übergehen. Am Dienstag Abend und in der Nacht zum Mittwoch zieht an der
sich etwas nach Osten verschiebenden Luftmassengrenze erneut ein
Regengebiet nordwärts, das seine Entstehung vor allem starker
Windscherung in der unteren Troposphäre verdankt. Auf der Rück- bzw.
Westseite der Luftmassengrenze kräftigt sich kurzzeitig eine bodennah
nördliche Strömung, in einigen Kilometern Höhe dagegen weht der Wind -
auf der Vorderseite des französischen Höhentiefs - noch immer aus Südost
bis Süd. Der Nordosten Deutschlands allerdings wartet zunächst weiter
vergeblich auf Niederschlag, dort wirkt nach wie vor der Einfluss eines
westrussischen Hochdruckgebietes.
Das Höhentief spaltet sich am Mittwoch in zwei Teile auf; der östliche
Part verlagert sich bis Donnerstag zur nördlichen Adria, ein Rest
verbleibt über Nordfrankreich. Am Boden füllt sich die Tiefdruckrinne
langsam auf, die Luftmassengrenze verliert ihre scharfen Strukturen. In
der zweiten Wochenhälfte etabliert sich ein ausgeprägtes Hoch mit seinem
Schwerpunkt über Finnland. An dessen Südflanke wird die warme und im
Bereich der dann ehemaligen Tiefdruckrinne feuchte Luft wieder nach
Westen geführt. In der Höhe baut sich bis zum Wochenende eine quer über
Europa reichende Zone hohen Geopotentials auf. Somit setzt sich in
Deutschland allgemein wieder sonniges und warmes Wetter mit der Neigung
zu tagesgangbedingten Schauern und Gewittern durch.
|